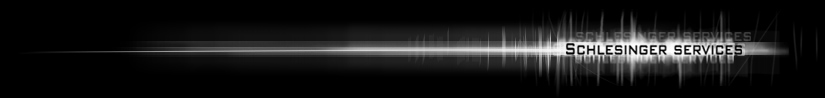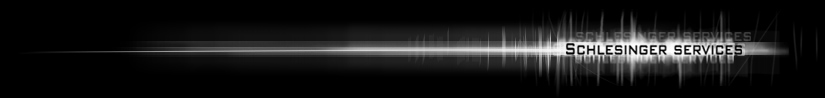|
Therese Schlesinger, eine Kämpferin für die
Gleichberechtigung der Frau, trug durch ihre Schriften und
Artikel zur Bewußtseinsbildung der Gesellschaft der Ersten
Republik bei. In ihren Publikationen rief sie zum Kampf gegen
Ausbeutung, Unterdrückung und Benachteiligung der
Arbeiterschaft auf und verschonte die Kirche und den Staat nicht
mit ihrer sachbezogenen Kritik, Sie wehrte sich gegen die
Ungerechtigkeit, die den Frauen der damaligen Zeit in allen
Lebensbereichen widerfuhr, und setzte sich mutig für die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft ein.
Nicht zuletzt wegen ihrer persönlichen
Bildungsbenachteiligung forderte sie Verbesserungen auf dem
Gebiet der Frauen- und Mädchenbildung, die über
Jahrhunderte stark vernachlässigt wurde, Besonders wichtig
war ihr die Bildung des Proletariats, vor allem der arbeitenden
Frau. Es gelang ihr, die Bildung als Waffe gegen die Ausbeutung
der Arbeiterschaft in ihren Schriften zu transportieren und trug
dadurch zur gesellschaftskritischen Bewußtseinsbildung und
politischen Aufklärung bei.
Therese Schlesinger, die auch heute noch ihren
Mitmenschen so viel geben könnte, wuchs in der liberalen
Atmosphäre eines freisinnigen jüdischen
Bürgerhauses auf. Ihre Eltern, Amalie und Albert Eckstein,
gaben ihr ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl, einen
besonderen Bildungsdrang, Grundsatztreue und die Liebe zur Jugend
mit. Sie lebten ihr Opferbereitschaft und Sozialgefühl vor
und wiesen ihr den Weg zur praktischen Solidarität und
Toleranz.
Ihr Vater, Chemiker und Erfinder, verwirklichte seine Ideen
durch den blau der ersten Pergamentfabrik in Europa. Die im
allgemeinen vorherrschende schlechte Arbeitssituation der
eingewanderten Arbeiter versuchte ihr Vater, Albert Eckstein, in
seinem Betrieb zu verbessern. Durch Arbeitszeitverkürzung
und Krankenversicherung konnte er seinen Arbeitern eine
Arbeitserleichterung schaffen, die sie der demokratischen
Gesinnung der Familie Eckstein zu verdanken hatten. Der innige
Zusammenhang des Betriebes mit dem Leben der Familie Eckstein
führte zum gemeinsamen Aufwachsen der Eckstein-Kinder mit
den Kindern der Arbeiterschaft. Diese Vertrautheit förderte
bei den Kindern Amalie und Albert Ecksteins eine große
Anteilnahme an dem Los der Arbeiter und ein tiefgreifendes
Verständnis für deren Situation. Der Wunsch nach
Mitarbeit zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen wurde
besonders bei Therese zur Lebensaufgabe.
Die Kinder wurden aber auch von der Intellektualität ihres
Elternhauses geprägt. Die Eltern besuchten wissenschaftliche
Vorträge und pflegten den Umgang mit bedeutenden
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kunst. Ihre
Söhne Friedrich und Gustav, durften studieren und erlangten
Bedeutung in der Wissenschaft und im Kampf gegen die Ausbeutung
der Arbeiterschaft. Therese Eckstein, spätere Schlesinger,
hingegen war der Besuch einer höheren Schule aufgrund des
vorherrschenden Bildungssystems, wonach Frauen keinen Zutritt zu
Universitäten hatten, verwehrt. Ihre Schulbildung
beschränkte sich auf volks- und Bürgerschule. Der
private Geschichtsunterricht, den sie zuhause erhielt und der
sich vorwiegend mit der Französischen Revolution
befaßte, und der Einfluß der klassischen deutschen
Literatur, hier vor allem die Freiheitsdramen von Schiller,
erzeugten in ihr eine Art unklaren Gefühlssozialismus.
Ihrem Bildungsdrang, dem sie beinahe versessen nachging,
verdankte sie umfassendes Wissen, das weit über ihre
Schulbildung hinausreichte. Vor allem nachts setzte sie sich mit
politischen, rechtlichen, frauenspezifischen und ideologischen
Themen auseinander. Ihre persönlichen schmerzhaften
Erfahrungen hatten sie für ihr Engagement für die
Zulassung weiblicher Studenten an die Universitäten und
für die Volksbildung generell motiviert.
Das politische Klima in dem Therese Schlesinger heranwuchs, war
einerseits von der traditionellen Monarchie und ihren
Umbruchstendenzen geprägt, und andererseits durch die neu
gewonnene Freiheit des einzelnen, aber auch dessen Not und
Unzufriedenheit aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Lage
im Land gekennzeichnet. Diese schwierige Situation in
Österreich fand in der Persönlichkeitsbildung der
jungen Therese und in ihrer Sozialisation ihrer Niederschlag.
Von der Existenz einer organisierten Arbeiterpartei erfuhr sie
erst im Krankenhaus, in dem sie mit großen Schmerzen viele
Monate verbringen mußte, Schlesinger wurde bei der Geburt
ihrer Tochter Anna mit Rotlauf infiziert und erkrankte an
Kindbettfieber. Zwei Jahre lang, in denen sie zweimal operiert
wurde, war sie bettlägrig. Sie behielt ihr Leben lang ein
versteiftes Hüftgelenk und ein verkürztes rechtes Bein.
Diese Behinderungen verursachten ihr, besonders im Alter,
große Qualen.
Die Maifeier des Proletariats, die 1890 zum ersten Mal
stattfand, verfolgte sie mit großen Sympathien vom Spital
aus. Ihr Interesse an öffentlichen und politischen Fragen
war jedoch durch weitere schwere Schicksalsschläge für
die nächsten Jahre eingeschränkt, denn als sie endlich
mit Krücken gehen konnte, starb ihr Mann Victor Schlesinger
nach nur 2 1/2 jähriger Ehe an Tuberkulose. Kurz darauf
wurde ihre Tochter Anna schwer krank und beanspruchte sie zur
Gänze.
Trotz ihrer Isolation, bedingt durch so schmerzliche Ereignisse
in ihrem Leben, verfolgte Schlesinger aufmerksam die
Aktivitäten der Wiener Arbeiterbewegung. Nicht ihr
politisches Bewußtsein, sondern ihr eigener Wunsch nach
Befreiung, der sich mit der Revolutionsromantik eines belesenen
bürgerlichen Mädchens verband, motivierte sie zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung. Ihre
Sehnsucht, sich über ihr persönliches Unglück
emporzuheben und an den großen Kämpfen ihrer Zeit
teilzunehmen, wurde immer lebendiger.
Eine Beteiligung an der Arbeiterbewegung schien ihr anfangs ganz
unmöglich, sie wußte auch nicht, wie sie sich Zugang
verschaffen könnte und fürchtete außerdem,
aufgrund ihrer bürgerlichen Herkunft zurückgewiesen zu
werden.
Die Genesung ihrer Tochter schritt voran und als sich ihr
eigener Gesundheitszustand stabilisierte, gelang es ihrer
Freundin Marie Lang, Therese Schlesinger für die Mitarbeit
im ,,Allgemeinen Österreichischen Frauenverein" zu gewinnen.
Dies stellte den ersten Schritt in ihrer aktiven politischen
Arbeit dar, in der sie vor allem die Verbesserung der sozial
schlechter gestellen Arbeiterschaft und die Gleichberechtigung
der Frauen forderte. Durch die Mitarbeit in dem bürgerlichen
,,Allgemeinen Österreichischen Frauenverein" wurde sie mit
den schweren Lebensbedingungen des weiblichen Proletariats
konfrontiert. Dies löste bei Schlesinger eine politische
Annäherung an den Sozialismus aus und erzeugte in ihr das
tiefe Verlangen, den Kampf gegen Unterdrückung und
Ausbeutung an der Seite der proletarischen Frauen zu
führen.
Schlesinger verließ den ,,Allgemeinen
Österreichischen Frauenverein" und trat 1897 der
sozialdemokratischen Partei bei. Nach mühevollem
Vertrautwerden mit den Grundsätzen und Theorien der
Sozialdemokratie, begann sie in der "Arbeiterzeitung" zu
publizieren. Ihre schriftstellerischen Aktivitäten wurden
umfangreicher und interessanter, da sie ein breites Spektrum an
politischen und gesellschaftskritischen Themen behandelte, die
ihr die Möglichkeiten gaben, ihren eigenen Bildungshunger
autodidaktisch zu stillen. Im Rahmen ihrer Agitationsarbeit
für die Partei beteiligte sie sich an den
Wahlkampfreranstaltungen und forderte das Wahlrecht auch für
die Frau.
Sie hielt Kurse und Vorträge für die Weiterbildung der
Arbeiterfrauen und nahm als Delegierte an der 1.
Frauenreichskonferenz der Sozialdemokraten teil, auf der der
Beschluß gefaßt wurde, das weibliche Proletariat
durch eigene Frauensektionen in den Gewerkschaften zu
organisieren.
Durch die intensive gewerkschaftliche Arbeit, die Schlesinger
nun aufnahm, gewann sie Einblick in das Wesen der Lohnarbeit und
in die Gedankenwelt des Proletariats. Schlesinger forderte auf
gewerkschaftlichen Veranstaltungen die politische Gleichstellung
der Arbeiterfrau und Maßnahmen gegen die Ausbeutung ihrer
Arbeitskraft.
Neben der Verbesserung der Lebenssituation für die
Arbeiterschaft war die Mädchen- und Frauenbildung eines
ihrer Hauptanliegen an den Staat, an die Gesellschaft und auch an
die betroffenen Arbeiterfauen selbst. Sie erkannte, daß nur
ausreichende Bildung und durch die damit verbundene
Aufklärung das Proletariat aus der Knechtschaft führen
konnte. Für diese politische Bewußtseinsbildung trat
Schlesinger in ihren Schriften und Feuilletons immer wieder
ein.
Therese Schlesinger wurde als eine der ersten
Sozialdemokratinnen am 4, März 1919 im österreichischen
Parlament für die Konstituierende Nationalversammlung
angelobt. Ihr erster Antrag, den sie im Ausschuß für
Erziehung und Unterricht stellte, war die Zulassung weiblicher
Schüler zu den Unterrichtsanstalten aller Kategorien.
Am 10.11.1920 erfolgte ihre Angelobung als Mitglied des
Nationalrats, in dem sie sich besonders für die
Mädchenbildung und den Kinder- und Jugendschutz einsetzte.
Sie wechselte 1923 in den Bundesrat, dem sie bis zum 5.12.1930
angehörte.
Als eine der ersten Frauen in der österreichischen
Regierung kam ihrer politischen Arbeit ein besonderer Stellenwert
zu. Ihre Themen, die sie in ihren Publikationen zur Diskussion
stellte, transportierten ihre Intention zur Bildung und
Aufklärung ihrer Leserschaft. Durch ihren brillianten
Schreibstil stellte sie politische Sachverhalte witzig, zynisch
oder aggressiv dar, und regte dadurch politisch Desinteressierte
zum Lesen vor allem ihrer Feuilletons an.
1933 schied sie aus Altersgründen aus dem Parteivorstand
aus. Ihre jüdische Herkunft zwang Therese Schlesinger mit 76
Jahren nach Frankreich zu emigrieren, wo sie 1940 starb.
Aus: Jaindl, Birgit 1994: Therese Schlesinger (Diplomarbeit Uni
Wien)
|
 |